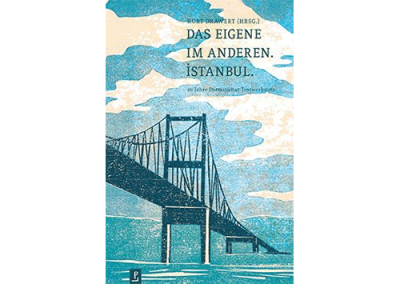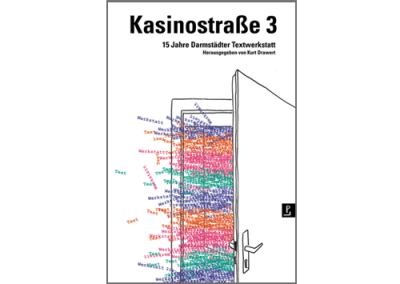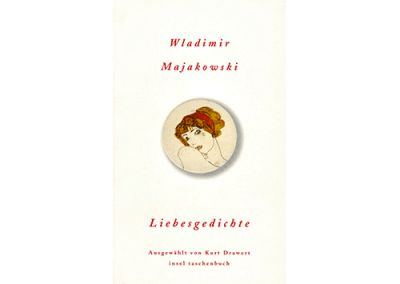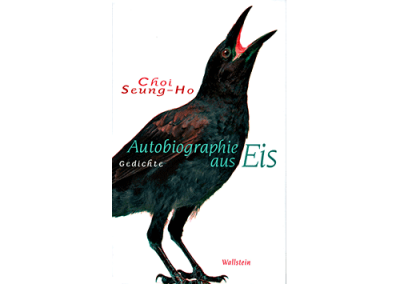Kurt Drawert
Schriftsteller
„Vom Glück der gefundenen oder vom Unglück der verlorenen Liebe zu erzählen, gehört zu den Urmotiven der Lyrik, denn nirgends ist der Mensch privater, intimer und auch verletzlicher als in jener unmittelbaren Beziehung zu einem anderen, und nirgends überschreitet er sich so rückhaltlos und total, wie in der Liebe.“
Aus dem Nachwort von Kurt Drawert
Nachwort von Kurt Drawert
I
Vom Glück der gefundenen oder vom Unglück der verlorenen Liebe zu erzählen, gehört zu den Urmotiven der Lyrik, denn nirgends ist der Mensch privater, intimer und auch verletzlicher als in jener unmittelbaren Beziehung zu einem anderen, und nirgends überschreitet er sich so rückhaltlos und total, wie in der Liebe. Aber Liebesgedichte geben in ihrer Art und Weise des Auftritts, ihrer Selbstverständlichkeit oder Verschämtheit, ihrer klaren oder verstellten Sprache immer auch Auskunft über die Umstände ihrer Entstehung. Im Falle Majakowskis nun muß auf diese doppelte Bedeutung gewiß nicht hingewiesen werden, denn es gibt kaum ein lyrisches Werk, in denen die Wechselwirkungen von Individuum und Gesellschaft, von privater Empfindung und allgemeiner Angelegenheit, von persönlicher und historischer Geschichte dermaßen kenntlich und poetisch durchdrungen sind. Gewiß gibt es das konkrete Liebesgedicht, in dem ein anderer Mensch mit Versen umarmt und festgehalten wird, aber das ist eher singulär. Hier ist das Genre prinzipiell größer und weiter zu fassen und auszudehnen auch auf die Liebe zu einer Idee. Und wenn es etwa heißt: »Es lebe die Revolution,/ die baldige, lichte!/ Der einzig,/ wahrhaftig/ erhabene Krieg/ von allen Kriegen/ der Weltgeschichte«, dann ist in diesen affektiv hochstürmenden Versen ein Potential an Leidenschaft enthalten, das bezogen auf einen anderen Menschen kaum größer sein könnte. Oft überschneiden sich die Motive der Liebe innerhalb eines Gedichtes, nehmen hier die Gestalt einer Frau an und dort die einer Sache. Das ästhetisch Problematische an Liebeslyrik ist ja der Versuch, einen einzelnen in der ganzen Tiefe eines Gefühls anzusprechen, und es doch so zu tun, daß der Leser, jener Dritte und Fremde im Bunde, nicht zum Voyeur wird. Wie indiskret und hermetisch, von Kitsch und sprachlichem Plunder heimgesucht mag sich da vieles gebärden, was als Liebeslyrik firmiert. Daß sich bei Majakowski selbst in frühester Jugend, die fraglos ein Recht darauf hat, literarisch danebenzugreifen, wenn es um die Bannung starker Empfindungen geht, keine einzige peinliche Zeile finden läßt, beweist die Außerordentlichkeit dieser lyrischen Stimme und die schnelle Reife eines Bewußtseins für Zeit und Geschichte. Wenn er in dem Poem »Wolke in Hosen«, das wir allein seines Umfanges wegen hier nicht mit aufnehmen konnten, eine Frau namens Maria anruft, die gleichsam eine Imagination aller Frauen in einer darstellt, dann sehen wir, wie poetisch abstrakt der Autor von Anfang an das Reale behandelt. Aber wie im Dispositiv dazu gewährt auch niemand einen tieferen Einblick, wie Poesie von ideologischer Inanspruchnahme beschädigt werden kann. Denn auch das muß gesagt sein: die Hymnen der Zukunftsverheißung und einer ins Politische gewendeten Religiosität, wie er sie in den 20er Jahren unter dem Eindruck von Revolution und Gründung der Sowjetunion schrieb, bewegen eine Menge agitatorischen Ballast und sind allenfalls noch ihrer besonderen lyrischen Techniken halber, wie der freien Behandlung des Verses und der Verwendung von Assonanzen, oder ideologiegeschichtlich interessant. Und wenn es gar heißt: »Das Kleine miß stets/ am gewaltigen Ziel.«, dann kann es einem heute eigentlich nur noch unheimlich werden. Auch das eine Schnittstelle wie die des Liebesgedichtes, das Innen- und Außenwelt in ihrer Gegensätzlichkeit miteinander verbindet: die Art und Weise der Reaktion auf ein historisch so großes Ereignis, wie die Oktoberrevolution von 1917 eines war. Eine ganze Generation von Dichtern und Künstlern ist von diesem Geschichtsverlauf auf mehr oder weniger tragische Weise mitgerissen worden; ob Sergej Jessenin im Suizid, über den Majakowski etwas belehrend schreibt: »Es gibt noch wenig Lust auf unserm Stern./ Man muß die Freude aus der Zukunft reißen./ In diesem Leben stirbt man leicht und gern./ Bedeutend schwerer ist: das Leben meistern.«, um ihm dann nur fünf Jahre später auf ähnliche Art und Weise zu folgen, oder Marina Zwetajewa im Exil, ob Anna Achmatowa in Armut und Isolation oder Ossip Mandelstam in der Verbannung – gescheitert oder doch um die Kraft ihrer Jahre gebracht sind sie alle. Auch Majakowski, der zunächst ein Kind der Revolution war, ehe er eines ihrer zahllosen Opfer werden sollte.
II
Als drittes Kind und einziger Sohn eines Försters wird Wladimir Wladimirowitsch Majakowski am 19. Juli 1893 im georgischen Bagdady geboren. Nach dem frühen Tod des Vaters durch eine Blutvergiftung und einem Umzug der Familie nach Moskau, kommt er mit 14 Jahren ans Gymnasium, wird dort aber, da die Mutter das Schulgeld nicht mehr aufbringen kann, nach nur zwei Jahren wieder entlassen. Er liest marxistische Literatur, sympathisiert mit der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, beteiligt sich an politischen Kundgebungen und wird wegen staatsfeindlicher Propaganda mehrmals verhaftet. Und er schreibt seine ersten Gedichte, die allerdings von den Aufsehern einer damals berüchtigten Haftanstalt konfisziert werden. 1912 erscheinen dann »Nacht« und »Morgen« in einem futuristischen Almanach. Gleichzeitig beschäftigt er sich mit Malerei und beginnt ein Studium an der Moskauer Kunstfachschule. Dort lernt er David Burljuk und Welimir Chlebnikow kennen, deren futuristischer Gruppe »Gileja« er sich anschließt.
Es folgen futuristische Manifeste und der Ausschluß aus der Kunstakademie zusammen mit David Burljuk sowie weitere Repressalien wegen revolutionärer Aufsässigkeit. Die Poeme »Wolke in Hosen« und »Die Wirbelsäulenflöte« erscheinen, und mit ihnen fängt der Lyriker nicht lediglich an, sondern ist, was Stilsicherheit und poetische Bildlichkeit betrifft, schon ganz auf der Höhe seiner Begabung. Auch thematisch ist bereits alles präsent: die Liebe, die Kritik an jeder Form von Bürgerlichkeit, die Religion – der ein Glaube an die Revolution folgen wird – und die Kunst. Das Neue und Ungewohnte an diesem lyrischen Sprechen ist sein Gestus der rhetorischen Unmittelbarkeit, der Sache und Satz fast als identisch behandelt und zum erzählerischen Langgedicht drängt. Hochmodern auch die Flüchtigkeit des reflektierenden Subjekts und die Verklammerung einander ausschließender Motive. In Abgrenzung zum Symbolismus eines Alexander Blok oder Imaginismus eines Sergej Jessenins entsteht so eine Lyrik, die sich für eine Darstellung des Alltäglichen ebenso eignet wie für den mündlichen Vortrag. Damit ist eine der Struktur nach offene lyrische Form geschaffen, die auch besonders geeignet für Agitation und politische Inhalte ist. In einer anderen, das Wort eher symbolisch konditionierenden Poetik wäre eine solche Instrumentalisierung der Lyrik kaum möglich gewesen. Hier wachsen ein poetisches Selbstverständnis, das zu einer Modernisierung des Metrums und einer eher unmetaphorischen, konkret bleibenden Bildlichkeit führen, und ideologischer Auftrag zusammen. Nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges meldet er sich an die Front, wird aber zurückgewiesen und arbeitet vorübergehend in einer Petrograder Fahrschule. 1915 macht er die Bekanntschaft mit Maxim Gorki, der zu seinem literarischen Ziehvater wird und einen sicher großen Einfluß auf seine politische Haltung ausübt. Im selben Jahr lernt er die mit dem Literaturwissenschaftler Ossip Brik verheiratet Lilja Brik kennen und verliebt sich in sie. Eine öffentlich beachtete Mènage á trois beginnt, zunächst noch in Petersburg, wo er sich im Palais Royal unweit der Briks ein Zimmer mietet, und ab 1920 in einer kleinen Wohnung in Moskau, die sie sich zu dritt teilen. Ossip Brik wird sein Verleger, der auch erstmalig das Poem »Wolke in Hosen« herausbringt, und Lilja Brik seine Geliebte und lyrische Muse, eine Art Beatrice der russischen Literatur. Nun ist viel darüber geschrieben und spekuliert worden, welchen Einfluß diese Beziehung zu den Briks auf sein Werk hat, denn gewiß sind vor allem die frühen Poeme und Gedichte wie »Lilitschka!« undenkbar ohne die reale Person Lilja Brik. Aber wäre nicht sie es gewesen, hätte es jemand anderen als initiales Moment für diese Dichtung gegeben, die sich ja gerade in der Verklammerung von Privatem und Geschichtlichem und in der Verallgemeinerbarkeit des Konkreten bewährt. Viel entscheidender sind die folgenden historischen Ereignisse, die alles vordergründig Persönliche zunehmend verdrängen. Und er begrüßt sie, die Revolution von 1917 und den Sieg der Bolschewiki mit dem ganzen Erlöserpathos, wie er wohl auch in der Zeit lag. Verse wie: »stark und rein/ wie noch nie/ faßt mein Geist/ das große/ Gefühl,/ das da Klasse heißt!« meinen es vollkommen ernst und sind keine Huldigung wider besseres Wissen. Majakowski schreibt in einer gesellschaftlichen Keimzelle, die noch ganz in ihrer Utopie verkapselt ist und über keine Erfahrungen mit sich selbst verfügt. Nicht unwesentlich für diese ideologische Empfänglichkeit ist auch die futuristische Idee der perfekten Maschine, die den Gedanken des »neuen Menschen« impliziert und in Verbindung mit den gesellschaftlichen Veränderungen als greifbar nah erscheinen läßt. Schon in dem Poem »Wolke in Hosen« von 1915 heißt es: »Ich, Verherrlicher der Maschine,/ der Techniken von Manchester und Boston,/ bin vielleicht im evangelischen Alltags-Sinne/ der dreizehnte Apostel.« Revolutionäre Idee und Verherrlichung der Technik, deren Grund in der Absage an einen Gott liegt und diesen zu ersetzen hat, gehen ineinander und lassen ein konstruiertes und idealisiertes Menschenbild entstehen: nietzscheanisch-transzendental auf der einen, heroisch-androgyn auf der anderen Seite der Geschichte. »Schafft eine neue Kunst,/ geeignet,/ die Republik aus dem Unrat zu heben!«, schreibt er 1921, dem Jahr der ersten großen Hungersnot in Folge katastrophaler wirtschaftlicher Zustände. Doch so sehr er sich auch müht, ein Arbeiter unter Arbeitern zu werden und eine Poethologie verteidigt, die das Schreiben von Gedichten gleichstellt mit der Produktion einer Ware: er bleibt doch ein Mann des Wortes und damit ein Intellektueller, der sich zu Volksnähe und Einfachheit immer wieder ermahnen lassen muß. Sein Konzept der Proletarisierung von Poesie geht nicht auf: die Sprache verflacht, um verständlicher für die Masse zu werden, bleibt aber noch immer zu sehr Literatur und damit suspekt. Ein unlösbarer Widerspruch und das beginnende Ende der Illusion. Ab 1922 reist er, nach Lettland, Frankreich, Deutschland und in die USA, wo er, ein glühender Verfechter seiner kommunistischen Überzeugungen noch immer und kurzzeitig sogar sowjetischer Vorzeigedichter, Elli Jones kennenlernt. Mit ihr bekommt er eine Tochter, die er allerdings erst 1929 in Südfrankreich das erste Mal trifft. Seine letzte Liebe wird dann Tatjana Jakowlewa heißen, die in einem 1928 verfaßten »Brief an Tatjana Jakowlewa« auch lyrisch verewigt ist. So sehr nun auch das Ausland ihn feiert, im eigenen Land gerät er zunehmend unter Druck, wird beargwöhnt und bespitzelt und schließlich von der Geheimpolizei systematisch in den Tod getrieben. Seine Komödien »Die Wanze« und »Das Schwitzbad«, in denen er die Verhältnisse des jungen sozialistischen Staates satirisch aufs Korn nimmt, werden durch Manipulationen der GPU, die Störtrupps in die Vorstellungen schicken, zu Mißerfolgen. Gesundheitlich geht es ihm schlecht, die Freunde und Weggefährten wie Boris Pasternak haben sich lange schon von ihm abgewandt, kurz: von dem Sänger der Revolution ist kaum mehr geblieben als ein Schatten seiner selbst. Und wie er es in einem frühen Gedicht prophezeite, geschieht es: am 14. April 1930 schießt er sich mit einer Pistole ins Herz. In seinem Abschiedsbrief heißt es: »Wie man so sagt, der Fall ist erledigt; das Boot meiner Liebe am Alltag zerschlug.«
III
Jeder stirbt zweimal, einmal physisch und einmal symbolisch. Majakowskis symbolischer Tod lag in Stalins fünf Jahre später geäußertem Bekenntnis: »Majakowski war und bleibt der beste, talentierteste Dichter der Sowjetepoche. Es ist ein Verbrechen, seinem Werk gleichgültig gegenüberzustehen.« Damit war er für die Sowjetliteratur kanonisiert und für den Sozialistischen Realismus vereinnahmt. Etwas Schlimmeres und sein Bild rezeptionsgeschichtlich Vergröbernderes konnte ihm kaum passieren. Denn Majakowski, der mindestens ebenso zersplittert war wie die Zeit, in der er wirkte, war von nun an etwas holzschnittartig der Barde der Arbeiterklasse und Sprachrohr der Revolution. Daß sich hinter dieser extrovertierten Schablone ein überaus verletzlicher Mann verbarg, wissen am ehesten die, von denen in den Liebesgedichten mal direkt, mal indirekt die Rede ist: die Frauen, die er oft genug unglücklich liebte. Sicher war er in einer Phase seines Lebens ein Irrläufer. Aber wollen wir auch nicht verkennen, daß die historischen Umbrüche von einer Unabweislichkeit waren, der sich keiner entziehen konnte. Entweder er wurde im Strudel der Ereignisse mitgerissen und ging darin unter, oder er übernahm eine Rolle (- und ging in dieser dann ebenfalls unter). Für ein lyrisches Temperament, wie Majakowski eines war, gab es da im Grunde keine Alternative. Nun ist Kunst immer auch eine kollektive Verabredung darüber, was Kunst ist oder werden kann, und damit ist sie an die Bedingungen ihrer Zeit gebunden. Im Falle Majakowskis waren die Bedingungen eher so, daß sie die Kunst, seine Kunst, schnell verbrauchen mußten. Mit einer Idee verschmolzen zu sein, die zur Ideologie geworden ist und eine politische Exekutive besitzt, ist natürlich in sich schon paradox – jedenfalls für einen Dichter, der nur aus der Freiheit seiner Sprache schöpfen kann. Am Ende war er es selbst, der aufs schärfste gerade deswegen mit sich ins Gericht ging, wenn er schrieb: »Auch mir/ wächst die Agitpropkunst/ zum Halse heraus«. (…) »Doch ich/ bezwang mich,/ trat/ bebenden Hauchs/ dem eigenen Lied/ auf die Kehle.« Kürzer und treffender könnte man kaum zusammenfassen, wie missionarischer Eifer mit Selbstverzicht gepaart zur existentiellen Tragödie werden. Was also bleibt, ist die Poesie hinter dem Bekenntnis, und da haben wir doch eine ganze Menge an Gedichten, denen der Verfasser nicht in pragmatischer Absicht »auf die Kehle« getreten ist. Und es sind, dieser Band möge es bestätigen, vor allem die Liebesgedichte.
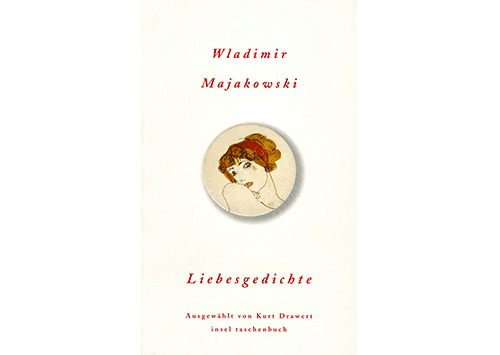
Wladimir Majakowski „Liebesgedichte“
Hrsg., Insel Verlag, Frankfurt am Main 2008
133 Seiten, Broschur, EUR 5,00
ISBN 978-3-458-35047-7