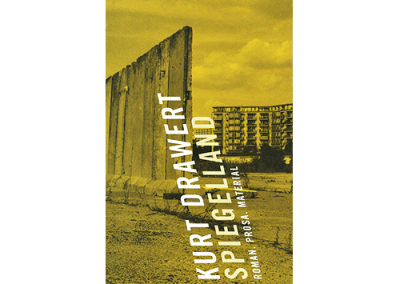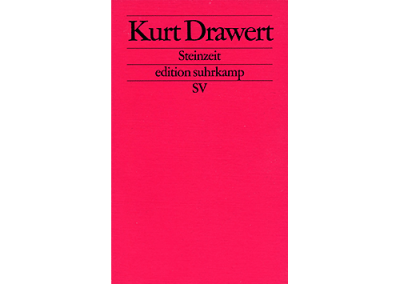Kurt Drawert
Schriftsteller
Unmittelbar nach dem Ende der DDR schrieb Kurt Drawert den Roman „Spiegelland“, der eines der eindrucksvollsten und bedeutendsten Zeugnisse über die historischen und biografischen Brüche ist, die diese dramatische Zäsur in unserer Geschichte zugleich hervorgerufen und sichtbar gemacht hat.
Mit dieser Ausgabe wird „Spiegelland“, ein Text, der sich seine Frische und Wucht unverändert bewahrt hat, wieder zugänglich, ergänzt um einen Essay.
Wer war ich, als ich es dachte und sah?
Eine Vorbemerkung
I
Es ist immer riskant, sich selbst in einer anderen Zeit zu begegnen. Wer war man, der so dachte und sah? Und warum war es nötig, so und nicht anders geschrieben zu haben? Ein literarischer Text, ein Buch, ist mehr als nur ein ästhetisches Objekt. In seinem innersten sprachlichen Kern nämlich findet ein Überschuss statt, eine Mehrproduktion, die sich entfalten, nicht aber darstellen und zur Sprache bringen lässt. Diese zweite, tiefere Bedeutung ist weder vom Autor zu beherrschen noch zu hintergehen &ndash sie stellt sich unwillkürlich ein, sobald wir lesen und interpretieren. Und sie ist das Herz, das wieder zu schlagen beginnt, als wären die Situationen und Affekte, die Eingang fanden in die besondere poetische Architektur eines Textes, nur in einer Art von Erstarrung gewesen bis zu diesem einen, sie neu belebenden Moment. Literatur zu verstehen als ein Archiv der Gefühle ist zwingend insofern, als es in ihr um eben nichts anderes geht als um die Geschichte einer Erregung, die die Geschichte, die erzählt wird, unabweislich begleitet, so wie auch ein Schatten seinem Gegenstand folgt. Der Ton macht die Musik, heißt eine tote Metapher, die sich aktualisiert, sobald sie für die Lektüre gebraucht wird. Es ist immer die Form, die über das Schicksal des Inhalts entscheidet. Denn warum sollten wir einer Aussage glauben, wenn sie unglaubwürdig klingt? Und wie kann ein Satz wahr sein, wenn er nicht schön, das heißt vollendet in seiner Form ist? Es gibt keine Wahrheit der Wahrheit, sondern nur die Überzeugung davon, die immer auch Überredung ist, Persuasion (vor der Nietzsche schon warnte, wenn sie dem falschen Gegenstand dient). Das gilt vielleicht nicht so sehr für die Naturwissenschaften oder die Mathematik – obgleich auch sie voller aporetischer Beschreibungen sind &ndash, aber es gilt unweigerlich für den Erfahrungsraum der Subjekte, die nur symbolisch, im Bauplan ihrer Sprache, miteinander in Kontakt treten können.
II
Nun ist Sprache nicht lediglich das Instrument der Reproduktion eines Wissens, das schon vorgängig ist, sondern auch ein System, in dem Wissen entsteht. »Die Sprache spricht«, heißt es bei Heidegger, und der Satz könnte meinen, dass Sprache ihren mythischen Urgrund, ihr Enigma, ebenso offenbart wie verheimlicht, auf- und zudeckt in gleicher (und gleichzeitiger ) Weise. »Die Sprache spricht« (uns aus); sie ist die Welt, die immer schon da ist und über uns verfügt, das Gesetz und der »Name des Vaters«. Aber sie ist auch das einzige Medium, durch das sich Erfahrungen machen und Erkenntnisse finden lassen können. Nur durch sie entgehen wir der rohen Natur und ihrer gnadenlosen Linearität, in der Rückblick und Vorausschau, Erinnern und Entwerfen nicht passieren können. Was ist, ist Sprache, oder es ist nicht. Das Reale hat keinen Status, der erkannt und erzählt werden kann, es ist eine Welt ohne Welt und ein Sein ohne Sein. Denn darum erzählen wir: um der Dunkelheit zu entkommen, die um uns herum fast ausnahmslos herrscht, der Kontingenz, die uns umgibt wie die Unendlichkeit, in der nichts zu einem Sinn sich fügt. Eine Erzählung aber muss Gültigkeit haben, sonst ist sie ungeschehen. Denn wir müssen glauben, was wir glauben sollen. Wir müssen dem Glauben glauben. Und wir müssen glauben zu wissen, was wir wissen. Denn auch das, was sich der Sprache entzieht, geht in sie ein. Falsch nur eben wäre, Erzähltes und Erzählendes als einander identisch zu denken und nicht zu erkennen, dass die Erzählung schließlich ihren Ort im Niemandsland der Differenzen hat. Dort nämlich, wo funktionales und rhetorisches Sprechen einander rivalisieren und Kenntnis geben von der Ambiguität und Paradoxie des menschlichen Lebens, kann das Erregende seine Gestalt annehmen und das Unbewusste in eine Form gebracht zum Vorschein kommen. – Wer also war ich, als ich es dachte und sah? Diesen Ort aufzusuchen, an dem sich die Erregungen ereignet haben, die Lust und der Schmerz, der Zorn, die Liebe, die erreichbar nur in ihrer Unerreichbarkeit ist – diesen Ort im Inneren der Literatur zu betreten ist deren höchstes Ereignis. Bei allem Verständnis für eine vorausgedachte Unbeschreibbarkeit der Welt – denn es wäre wohl recht naiv, wollte man glauben, die Sprache könnte etwas anderes erschaffen als sich selbst &ndash, gibt es dennoch mehr als nur Ohnmacht des Sprechens den Dingen gegenüber, die es benennt. Wir müssen nur eben von ihnen sprechen (und nicht über sie). Allein darin begründet sich die Poesie.
III
Wer nach der Wahrheit sucht, muss solange lügen, bis er sie findet. So wurde ich Schriftsteller. Nein, ich wurde Schriftsteller, weil es nichts anderes gab, was ich hätte werden können. Nein, ich wurde Schriftsteller, weil ich etwas werden wollte, was es nicht gab. Nein, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht wollte ich auch nur widersprechen. Wahrscheinlich das. Denn meine Rede musste das Gegenteil der Rede meines Vaters sein, denn wäre sie nicht das Gegenteil der Rede meines Vaters gewesen, wäre ich geworden wie er, und dann wäre ich auch niemals Schriftsteller geworden, sondern etwas, für das ich nicht hätte zuständig sein können. Und hier stoße ich auf eines der ersten Worte aller Missverständnisse bis heute: »Vater«, »der Name des Vaters«, das Gesetz, die Sprache, der Staat und die Macht. Es mag an meiner – durchaus auch sehr konkreten, familiären &ndash Herkunft liegen, dass sich die Konnotationen vermischen und ein Zeichen zum Homonym für ein ganzes Feld weiterer Zeichen geworden ist. Das aber ist kein privater Vorzug oder Nachteil, kein Idiolekt, der erst noch übersetzt werden müsste, sondern gesellschaftliche Konstitution und durchaus politisch. Denn die Verschmelzung einer äußeren Realität mit den innersten Bedürfnissen und Begehrensanlässen eines Einzelnen ist nirgends so groß wie in einer zentralorganisierten Diktatur, die das Subjekt schon in sich aufgenommen hat wie der größere den kleineren Fisch. Ichbehauptung war das politischste Unternehmen, das einer allein austragen konnte, und erst später verstand ich, dass ich gerade damit die Verhältnisse am schärfsten kritisierte (und wirksamer noch, als hätte ich die Verhältnisse namentlich und direkt kritisiert, um selbst zu ihrem Bestandteil zu werden). So ist auch das Wort »Ich« im Konnex meiner Erzählung mehr als nur »Ich ist ein anderer« in der modernen Psychoanalyse. »Ich« ist eine Ikone, eine Einschreibung in die Idee des Widerstandes.
Der Bildungsverlauf des Ich war dadurch, apriori politisch zu sein und übergangslos vergesellschaftet zu werden, von seinem natürlichen Zirkel, über eine narzisstische Lust nach sich selbst auf den Anderen zu schließen, abgeschnitten. Es gab eine direkte Korrelation zu den Strömen der Macht &ndash und genau dieser Übersprung einer imaginären Funktion hat zu Auslassungen und Verwerfungen in der symbolischen Ordnung geführt. Leider fehlt hier der Platz, das weiter und genauer auszuführen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist nur die Erkenntnis, dass die Sprech- und Verstehenssysteme (und gerade auf dem Felde der Literatur) in einer Art und Weise divergierend Sinn und Bedeutung erzeugten, dass von adäquater Rezeption und/oder Kommunikation nach der Wiedervereinigung nun wirklich nicht die Rede sein konnte. Im Gegenteil: Alle Texte wurden über Nacht stumm, denn es gab keine Stimme mehr, die sagte, was nicht mehr auf der Zeile stand. Historisch betrachtet, waren sich Ost und West einander so unverständlich und fremd, dass jeder einen Übersetzer gebraucht hätte, um seine eigene Sprache zu verstehen. Und wenn es dennoch zur Verständigung kam, war es eine geglückte Fügung des Irrtums. So waren mir die Lesarten von »Spiegelland« – ich verlasse jetzt meinen Schutzraum der Theorie und werde nun doch noch konkret – oft erschreckend. Gerade dort, wo sich die Emphase des Lesens auf ein Mitgefühl einließ, dass nicht mehr der Figur, sondern der Person galt, deren Produkt sie war. Ich habe mich (selbst) nie als besonders wichtig empfunden, und ich wollte auch nie erkannt oder beobachtet dabei werden, wie ich lebe oder auch nicht. Doch ich wurde mir gerade dann immer ähnlicher, sobald ich anfing, die Spuren der Realität zu verwischen und eine neue Topologie zu erfinden. Dann wieder dachte ich, ich könne verschwinden, indem ich erscheine. Aber wie man es auch wendet und dreht: Ein Autor kann sich nie selber verschweigen (wie auch ein Leser immer sich selbst liest) – nur das Bewusstsein dafür ist nicht jedem gleichermaßen gegeben oder überhaupt ausgebildet. Wie gelungen oder auch nicht können nur andere entscheiden. Eine Prämisse aber hatte ich immer beim Schreiben: meine Singularität stellvertretend für eine Sache zu fassen und ihre Schnittstellen zu suchen, ihre Einlassungen und Transzendenzen, die sie dann allgemein werden lassen und vielleicht exemplarisch. Das Große im Kleinen erkennen und das Ganze im Detail – ein Anspruch, dem das Scheitern schon beigegeben ist. Aber nichts will ich mehr, als den höchsten Punkt der Betrachtung zu finden, der immer, von Text zu Text neu, ein anderer ist. Dabei ist eine Grenze gezogen, die ich niemals unterschreiten möchte: »Ich« ist nicht Ich wie »Vater« nicht der Vater ist. Es gibt keine Wortwörtlichkeit, wenn man eine unsichtbare Welt erkundet, und es gibt keine Literatur ohne die Rhetorik der Tropen. Dabei spielt es keine Rolle, dass die Orte existieren, in denen geschah, was erzählt wird. Die Wirklichkeit spielt keine Rolle, denn niemals kann sie zur Wahrheit werden ohne eine Permutation ihrer Teile. Es kann also nie darum gehen, die Erfindung von Wirklichkeit im Text mit jener des Realen – was immer das im Einzelnen heißt – in ein Verhältnis zu bringen, um dann die Sprünge, Risse und Inkohärenzen zu beklagen, die aus diesen Vergleichen erwachsen (denn Kontinuität, und erst recht die einer erzählten Geschichte, ist immer eine erfundene). Entscheidend ist vielmehr, was produziert die Geschichte über sich selber hinaus? Welche Stimmungen lässt sie zurück? Welche Gefühle, Affekte, Aversionen? Und nicht: geschah es an einem Montag, Dienstag oder Mittwoch. Denn wahr ist allein: es geschah immer an einem anderen Tag.
IV
Wer also war ich, als ich es dachte und sah? Bei Hegel fand ich den Satz: Ich schreibe, um einmal zu wissen, was ich schon wusste. So ähnlich lese ich mich auch, denn ich fühle, was ich fühlte, als es geschah. Davon nun handelt alle Literatur: eine Archäologie des inneren Lebens zu hinterlassen, eine kurze Spur der Erkenntnis in der langen Geschichte der Unwissenheit. Der Stoff ist dabei nicht von Belang &ndash obgleich er gewiss auch nicht austauschbar ist, denn wir haben keinen anderen als eben den, den wir haben. Nur ist der Stoff nicht der Sinn, sondern die Folie, auf der er sich öffnet. Oder wie Flaubert es notierte: »Was mir schön erscheint und was ich machen möchte, ist ein Buch über nichts, ein Buch ohne äußere Bindung, das sich selbst durch die innere Kraft seines Stils trägt, so wie die Erde sich in der Luft hält, ohne gestützt zu werden.« Und dann schrieb er eine der schönsten Liebesgeschichten der Weltliteratur. Denn natürlich, bei aller Verteidigung der Literatur vor den Zumutungen ihrer Realitätszuweisung und anekdotischen Ersatzbefriedigung, sagt sie eben auch etwas, und eben nicht nur als Form. Wir können uns diesem »Sie sagt es« aber erst dann zuwenden, wenn wir den Umweg über ihr »Wie sagt sie was« durchlaufen haben. Ich bin nämlich überhaupt nicht der Meinung wie etwa Paul de Man, dass sich Literatur in ihrer Dichotomie von lexikalischer und figurativer Funktion quasi auslöscht und nur eine leere Hülle hinterlässt. Das wäre mir wirklich zu wenig. Eher halte ich es mit Sartre: »Wenn die Literatur nicht alles ist, ist sie der Mühe nicht wert.« Denn ja: Ich habe genau das erzählen wollen, was ich erzählt habe, hin oder her, wie (und ob) man es lesen kann. »Spiegelland« ist mir auch heute noch – oder vielleicht gerade erst heute, wo der zeitliche Abstand so vieles auch bestätigt hat, was in den 1990er Jahren noch traurige Vorausschau war – ein besonderes, wichtiges, persönliches Buch, durch das ich mich wahrscheinlich mehr verändert habe als durch alle anderen Bücher. Ich habe gelitten, als ich es schrieb. Ich habe gelitten, als es erschienen war. Und ich leide, wenn ich es lese oder gar vorlesen soll. Denn außer in meinen Gedichten ist kein Textkörper so sehr durchdrungen von existentieller Verzweiflung wie dieser. Und es ist nicht nur die Verzweiflung eines pubertierenden Joseph Giebenrath der DDR, der gleichsam dort »Unterm Rad« gelebt hat, sondern eines Ichs in seinem einzigartigen Recht auf sich selbst. Das macht den Stoff zur Allegorie und die Person zur Figur; so hoffe ich es; so wünsche ich es. Und tatsächlich haben ja Leser im Westen (eigentlich fast nur im Westen, weil das Buch für Leser im Osten zu früh kam) diesen Roman einer Kindheit und Jugend im Korsett der Diktatur verstanden, so als wäre es auch ihre Geschichte gewesen.
V
Ich wollte immer, dass ich das Andere sage, das zu sagen niemals abschließend gelingt. Dennoch ist mir die DDR, wenn ich jetzt daran denke, so fern, als wäre sie nichts gewesen als ein kurzer, verstörender Traum, und so lächerlich wie eine Ente, die auf dem Dorfteich den Schwan spielt. Am lächerlichsten aber und eben auch am kurzsichtigsten ist mir jede Selbstbezüglichkeit mit dem Beigeschmack der Nostalgie und einem Bedeutungshochmut für im Grunde fast nichts – und das meine ich bezogen auf alle Erinnerungskulturen, die andere kategorisch verneinen, ohne zu wissen, dass sie nur durch sie legitim sind. Ich glaube, keine Nation wie die deutsche hat sich so lange und akribisch damit beschäftigt, aus den Zetteln und Schnipseln eines an sich selbst erstickten Systems das Bildnis ihrer Machtanmaßung und Freiheitsberaubung zu rekonstruieren, und nichts war (und ist) richtiger als das. Nur ärgert und nervt es mich ungemein, wenn im Abstand eines Vierteljahrhunderts oft noch immer keine objektivierenden Verhältnismäßigkeiten und Bezugsparadigmen zum historischen Gesamtgeschehen hergestellt werden, sobald es um die politischen Epiphanien der DDR geht. Die Distribution des dokumentarischen Materials ohne neue oder erweiterte Fragestellungen gleicht dem Wiederholungsritual eines Zwangsneurotikers, der alles, nur eben nicht sein Symptom verlieren will. Den Opfern, die heute noch auf ein Wort der Entschuldigung warten – sofern dieses Wort überhaupt erwartet werden kann, da es die, von denen es erwartet wird, nicht besitzen –, geht es dadurch nicht besser, dass sie immer wieder auf die Geschichte ihrer Kränkung verwiesen werden; eher noch übernimmt sie die Rolle einer Substitution für Konflikte, die jetzt akut und oft auch unverständlich sind. Keine Zukunft ohne Vergangenheit, aber ohne Gegenwart ebenso nicht. Auch diese Markierungen finde ich vor allem in meinen Essays dieser Jahre: über die DDR hinaus zu denken und sie zu sehen als einen Teil in einer kolossalen Geschichte. Es gab zwei Systeme und eine Mauer, die sie scharf voneinander trennte, aber immer gab es auch einen gemeinsamen Kreislauf, der sie miteinander verband. Das erzählt mir mein Buch, heute, jetzt, dankbar, dass es erscheinen konnte in einem auf andere Weise durchaus ernsten Moment.
Kurt Drawert, Istanbul, im August 2014.

Spiegelland. Ein deutscher Monolog
Verlag C. H. Beck, München 2020
Die Erstauflage erschien 1992 im Suhrkamp Verlag.
160 Seiten
EUR 18,00
ISBN 978-3-406-75540-8