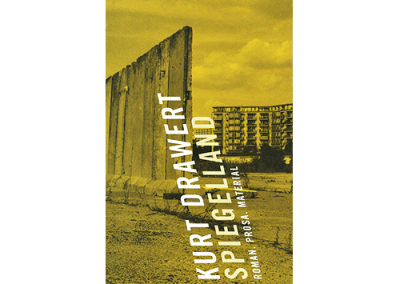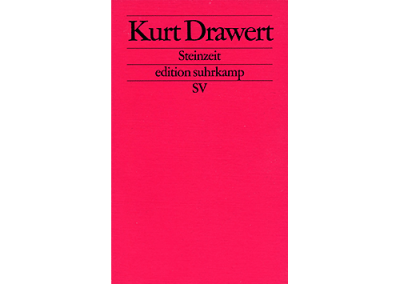Kurt Drawert
Schriftsteller
Spiegelland. Ein deutscher Monolog ist ein essayistischer Roman und das erste Prosabuch des in Leipzig lebenden Autors Kurt Drawert, der sich als Lyriker mit dem Gedichtband Privateigentum einen Namen machte. Spiegelland. Ein deutscher Monolog gründet auf den Erfahrungen eines Lebens in der untergegangenen DDR.
In diesen Monologen der Selbstvergewisserung, geschrieben im Zeitraum von fünfzehn Monaten zwischen 1990 und 1991 in Schleswig-Holstein, setzt sich Kurt Drawert in kunstvoll gefügten Sprachbewegungen der Erinnerung und der ‚Wiederholung‘, erzählend und reflektierend, mit der eigenen Biografie und der Geschichte des Herkunftslandes auseinander – um das eigene biografische „Niemandsland“ besser zu verstehen.
„Denn der Gegenstand des Denkens ist die Welt der Väter gewesen, von ihr sollte berichtet werden, und wie verloren sie machte und wie verloren sie war – als herrschende Ordnung, als Sprache, als beschädigtes Leben.“
»Seinen Söhnen ›im Sinne einer Erklärung‹ hat Drawert diesen Text gewidmet. ›Spiegelland‹ ist, genau in diesem Sinne, das erste Buch eines ehemaligen ›Hineingeborenen‹ in die nunmehr vergangene DDR. Angesichts der Gedichte seiner Klientel vom Prenzlauer Berg hatte Gerhard Wolf einst in Aussicht gestellt: ›Ihre Psychogramme sind noch nicht geschrieben‹. Drawert hat das Seine getan, eine Sprachlosigkeit zu überwinden, die eine ganze Lyrik-Generation nur kommunikativ innerhalb eines Insiderkreises machte. Ob ihm andere ›im Sinne einer Erklärung‹ folgen werden und möglicherweise weitergehen als Drawert, der das Porträt des jungen Dichters aussparte, wird sich zeigen. Möglicherweise aber kündigt ›Spiegelland‹ einen Generationswechsel im literarischen Bild des ›Was bleibt‹ der DDR an, eine postume Wachablösung der DDR-Literatur.«
Aus: »Beim Aufsagewettbewerb unterm Tannenbaum. Hineingeboren in die DDR, um sie zu entlarven: Der Lyriker Kurt Drawert« von Siegfried Stadler, Frankfurter Allgemeine Zeitung am 10.4.1993.
»Kurt Drawert schafft seinen Text als Sprach-Begegnung und Sprach-Prozeß mit den mißbrauchten Worten und Begriffen, mit Fotos familiärer Erinnerung, mit den repressiven Bildern der Vergangenheit. Die Lust und die Trauer und die Wut, alles hinter sich zu lassen, sind Anfang und Ende des Textes, jedoch nicht im Sinne einer Flucht, nicht Eskapismus ist Drawerts Devise, eher eine ›Notlage des Körpers, ein gespaltener Empfindungszustand, ein dauerndes Mißverstehen zweier gegengerichteter sprechender Figuren‹. …Nein, er wird sie nicht los, diese DDR, die jetzt für ihn ein einziger Intershop ist. Nur in der Sprache, nur im Auseinanderfalten der einst furchtgebietenden und moralischen Anspruch erheischenden Begriffe befreit sich der Lyriker Drawert durch sein essayistisches Poem. … Unter den vielen Versuchen ehemaliger DDR-Autoren ist Drawerts sprachkritischer Text die bislang angemessenste und in der literarischen Form modernste Antwort auf den Zusammenbruch der DDR.«
Aus: »Nicht sprachlos, heimatlos. Kurt Drawerts deutscher Monolog Spiegelland « von Hans-Jürgen Schmitt, Süddeutsche Zeitung am 10.11.1992
»Kurt Drawert ist früh und verdient mit seinen Gedichten aufgefallen; 1989 wurde er mit dem Leonce-und-Lena-Preis ausgezeichnet. ›Spiegelland‹ ist sein erstes Prosabuch, und es ist mehr als eine Talentprobe. Daß Kunst etwas anderes ist als die Kopie oder Spiegelung der Wirklichkeit, die ihrerseits nichts anderes ist als Spiegelung der Vorstellung, wie Wirklichkeit auszusehen habe – diese poetologische Überzeugung ist, nie explizit formuliert, dem Text immanent und muß mitgelesen werden. ›Spiegelland‹ ist weder Erzählung noch Beschreibung, ist weder Essay noch einfach ein Dokument einer bestimmten historischen Situation. In kreisenden und bohrenden, aufgestauten und weiterdrängenden Sätzen, pathetisch und reflektierend, werden die Materialien einer Biographie um und um gewendet. Dabei ereignet sich das Erstaunliche, daß diese Erinnerungsfragmente durch die kunstvollen Sätze nicht etwa zerrieben werden; sie gewinnen in der Reflexion eine seltsame Transparenz… Und, seltsam genug, gerade diese Verfremdung bewirkt, daß das Buch einem nahegeht. Es leistet etwas anderes und mehr als jene detailreichen Werke, an denen kein Mangel besteht: es erhellt die Vergangenheit, die DDR als Teil der deutschen Geschichte, gleichsam von innen.«
Aus: »Ein deutscher Monolog. Zum ersten Prosabuch von Kurt Drawert« von Elsbeth Pulver, Neue Zürcher Zeitung am 11.1.1993
Begründung zum ersten Uwe-Johnson-Preis:
»In seinem ersten Prosawerk erkundet der Autor durch eine kunstvolle Mischung von Erzählung und Reflexion seine eigene Geschichte und die der untergegangenen DDR. Dadurch verhilft sein Monolog dem Vergangenen zur Gegenwärtigkeit – vor allem in seiner Auseinandersetzung mit der Biographien bestimmenden deformierten Sprache. Auf diese Weise eignet Kurt Drawerts ›Spiegelland‹, indem es von einer vergangenen, aber noch längst nicht überwundenen Zeit erzählt, eine der für Uwe-Johnson wichtigsten Dimension des Erzählens – die des Erinnerns.«Neubrandenburg, den 23. September 1994
1
… gewiß hätten wir auf die Frage, woher wir denn kämen, kurz und verbindlich antworten können, aber es muß in uns beiden in demselben Augenblick das Gefühl geherrscht haben, heimatlos zu sein, so daß sie »aus Sonnenstadt« antwortete und ich, »aus Utopia«. Wir lachten, während der Mann etwas verwirrt war und sein freundliches Interesse an uns lächerlich gemacht sah, ohne indes verstehen zu können, daß wir nicht seine Frage, sondern die Antwort ins Lächerliche brachten, denn wir müssen sehr genau empfunden haben, daß die Stadt unserer Herkunft nicht die Stadt unserer Heimat ist, und daß wir nicht der Stadt unserer Herkunft entsprechen und mit ihr nichts zu tun haben wollen und nach ihr nicht gefragt werden und gleich gar nicht mit ihr in einem Zusammenhang erscheinen wollen, der nur ein äußerer Zusammenhang sein kann. Und wie es weder eine Sonnenstadt gibt noch ein Utopia, so gibt es keine Heimat, sondern immer nur Herkunft, am ehesten noch, dachten wir, als wir vor einiger Zeit in einem polnischen Krankenhaus lagen, verleiht die gemeinsame Sprache dem Wort Heimat eine Bedeutung, aber die gemeinsame Sprache ist auch nur äußerlich eine gemeinsame Sprache und kann im tieferen Sinn einer Verständigung eine ganz und gar unverständliche Sprache sein, denn es gibt keine Heimat, wenn es sie in einem selbst nicht gibt, und ich kann jede Stadt und jede Landschaft und jede Herkunft entschieden verlassen, denn ich verlasse immer eine Fremde und tausche sie aus gegen eine andere, unbekanntere Fremde, ich verlasse eine Stadt oder eine Landschaft oder eine Herkunft in dem Gefühl, einen Zusammenhang mit ihr leugnen zu müssen und nach ihr gefragt zu werden als lästig zu empfinden. Man müßte, denke ich, in geregelten Abständen eine Stadt und eine Landschaft und eine Herkunft verlassen. Man müßte immer wieder die Dinge verlassen, die man um sich aufgebaut hat. Man müßte das Bild verlassen, das sich die anderen von einem machen und dem man aus Gewohnheit entspricht. Seinen Namen und seine Worte müßte man entschieden verlassen von Zeit zu Zeit. Die Romane im Kopf müßte man verlassen und die Geschichte des Körpers. Die Semantik der Sprache müßte man verlassen, vergessen und verlassen, Mutter hockte nieder vor mir und lehrte mich »Arbeiter- und Bauernstaat« schreiben, ihre von der Kochwäsche aufgewallten Haare fielen verzottelt ins Gesicht, ich war aber auch ein zu blödes Kind, das komplizierte Wort »Revolution«, danach die Fahrt mit dem Fahrrad bis nach Hennigsdorf durch den Wald. Ich saß auf dem Gepäckträger und träumte, als wir im Sand steckenblieben und stürzten, all diese Stürze, die ich erlebte und sah, neben uns im Gebüsch hockten friedliche Russen, Mutter war voller Angst und schwitzte, der Korb mit frischen Pilzen rutschte vom Lenkrad, kippte um und verschüttete den Inhalt, den sie nicht auflesen wollte in ihrer Eile und Furcht, sie wollte nur diese einst so vertraute und plötzlich gefährliche Stelle verlassen so schnell es ging, der Sandweg war aufgerissen von Panzerfahrzeugen, die mit Strauchwerk getarnt zwischen Bäumen standen, am Abend kam Vater nicht nach Hause, was geschehen war, hieß Grenze. Diese Schwierigkeit mit den Worten. Ich war aber auch ein zu blödes Kind. Der Nachbar schloß seinen Geräteschuppen ab, drehte sich zur am Gartenzaun jätenden Mutter, neigte sich ihr etwas entgegen und sagte, Ist es denn mit dem Lesen und Schreiben schon besser geworden? Naja, stöhnte sie, wir üben gerade hundertmal »Arbeiter- und Bauernstaat« und »Revolution«, ich stand in der Brombeerenhecke und dachte an Bärbel, die ihr Alter schon gründlich verließ, wie es hieß überall in der Siedlung. Ich stellte sie mir nackt in den grasbewachsenen Bombenlöchern der weiten Heide hinter dem Haus vor, wie sie mir zuruft, Zeig doch den Pimmel, na los, zeig doch, und ich war, während mir bei den Worten Gebüsch, Busch, Heide, Gras, Wiese, Farn oder Bombenloch, grasbewachsenes Bombenloch, im Farn liegendes Bombenloch, grasbewachsenes, im Farn liegendes Bombenloch zum Verstecken, zum Verstecken mit Bärbel, ganz heiß wurde in der Brust, so schlecht in Grammatik, malte die Rehe immer noch grün, Mutter übte bis weit in den Abend hinein mit mir die Wirklichkeit sehen, bis mein Rücken sich krümmte. Die Schultern sackten nach vorn, da mußte etwas getan werden, ein wirklich blödes Kind, das nun auch noch einen Buckel bekommt, ich hing, das dachte Vater sich aus, an der Teppichstange, solange die Arme mich hielten, ein Zustand, in dem ich gerade war, wie alle es liebten, Zeig doch deinen Pimmel, ich stellte sie mir nackt, nackt in den grasbewachsenen Bombenlöchern der weiten Heide hinter dem Haus vor, ich stand in der Brombeerenhecke, während er fragte, Ist es denn mit dem Lesen und Schreiben schon besser geworden? Da draußen die mit Strauchwerk getarnten Panzerfahrzeuge, ich sehe, wie Mutter mit dem Fahrrad im Sand steckenbleibt, wie wir stürzen, der Korb mit frischen Pilzen rutschte vom Lenkrad und verschüttete den Inhalt, das komplizierte Wort »Revolution«, die Geschichte des Körpers ist hinlänglich beschrieben, und man muß sie verlassen, man muß seine Herkunft verlassen, und man muß die Worte der Herkunft verlassen und deren Bilder und alles, was an sie erinnert. Und man verläßt sie, indem man sie ausspricht, wir müssen alles erst einmal sprechen, um es dann zu verlassen, wir sagen unseren Namen, und wir haben unseren Namen verlassen, wir sagen unsere Liebe, und wir haben unsere Liebe verlassen, wir haben eine Sprache, um die Sprache zu verlassen, und so verlassen wir uns selbst, um uns selbst zu erreichen, ich kann eine Stadt und eine Landschaft und eine Herkunft, ob es dieser holsteinische Ort ist oder das Sachsen oder das Märkische meiner Kindheit, ohne Trauer verlassen, ich kann mich ins Auto setzen und losfahren und ohne Mühe alles und für immer verlassen, denn es gibt keine Heimat, wenn es sie in uns selbst nicht gibt. Und heimatlos sind wir doch alle.
2
… doch mit dem Land sterben die Begriffe noch nicht, die es hervorgebracht hat, wir haben, sagte ich zu W., den ich zufällig, nach fast zehn Jahren, wiedertraf, mit Begriffen gelebt und mit einer Sprache gelebt, die über Existenzen entschied und über Biografien, ritualisierte Verständigungssätze, magische Verkürzungen, Formeln der Anpassung oder der Verneinung, auswendig gelernt, dahingesagt, die Verformung der Innenwelt durch die Beschaffenheit der Wörter. (…)

Spiegelland. Ein deutscher Monolog
Roman
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1992
es 1715, 157 Seiten, DM 16,80
ISBN 3-518-11715-7