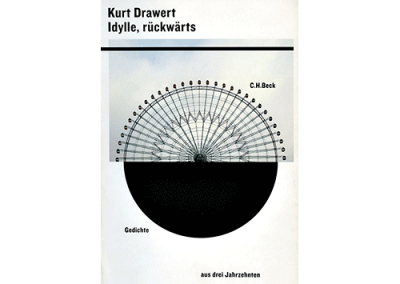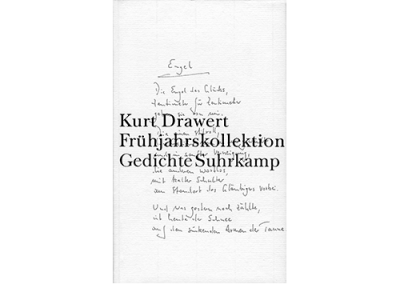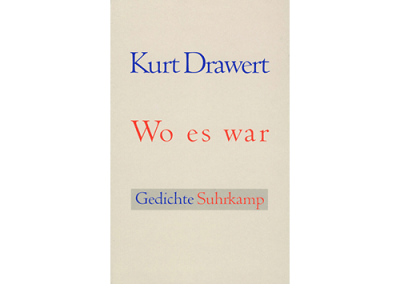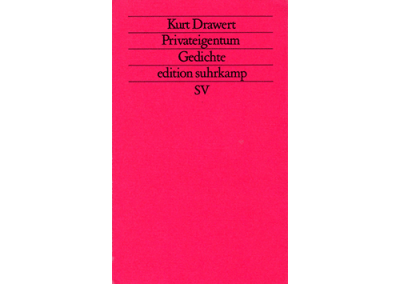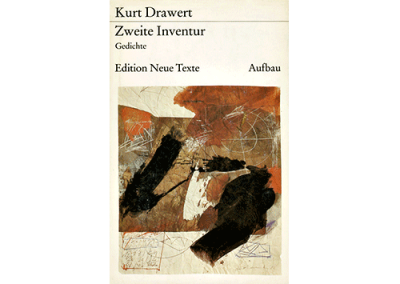Kurt Drawert
Schriftsteller
Kurt Drawerts Gedichte sind Zeugnisse einer unbestechlichen, außerordentlich präzisen Sicht auf die Dinge. Sie fragen nach unserem Herkommen, ziehen nüchterne Bilanz und verweigern sich nicht dem vernunftlosen Träumen. So findet sich die Klage über Versehrungen neben der Feier des Schönen im Gedicht, das immer auch nach der eigenen Bestimmung und dem Sagbaren fragt.
Es gibt viele schöne Dinge / für ein Gedicht, die ein Gedicht / nicht mehr brauchen,/ weil sie schon schön sind, heißt es etwa, und weiter: Aber immer, zwischen den Zeilen,/ bleibt etwas übrig. Gelassenheit ohne Selbstgewissheit zeichnet die Texte aus, die eine Bewegung des Suchens beschreiben und scheinbar gesicherte Antworten in Frage stellen. Der Vielfalt an poetisch verarbeiteten Sujets, in denen sich kultur- und gesellschaftskritische Themen mit individueller Erfahrung verbinden, entspricht der Formenreichtum dieser Gedichte. Er reicht vom strengen Metrum mit Reimbindung bis zum elegischen Langvers, vom Lakonischen bis zum Narrativen, vom „klagelied (barock)“ bis zum Rollengedicht. Dass Ironie und Selbstironie immer wieder in den Texten aufblitzen, ist gewiss ein neuer Ton bei diesem Autor, der als Lyriker begonnen hat, sich aber längst auch als Prosaautor, Dramatiker und Essayist einen Namen machte. Die drei Kapitelüberschriften geben eine Andeutung von dem weiten thematischen Bogen, den die Liebesgedichte, die Reisegedichte, die Gedichte über Städte und Reservate der Natur innerhalb eines komplexen gedanklichen Unterwegsseins spannen: Ich liebe Industriegebiete; Die Engel der Landstraße; Geld & Gedichte.
»Grenzgänge, nüchterne Verunsicherungen und Untergangsszenarien sind die Sache Kurt Drawerts, einer der wichtigsten und unbestechlichsten poetischen Stimmen im Lande. (…) Seine Gedichte treten in der ganzen Selbstverständlichkeit ihrer Sprache auf, weil sie Form, Gedanken und individuelle Erfahrung zur Überseinstimmung bringen.«
Joachim Sartorius in der Süddeutschen Zeitung v. 27.8.2002
»Drawert gehört nicht zu den Autoren, deren Texte schmeichelnd zur Lektüre einladen, den Leser mit Cocktails empfangen und mit Gags bei Laune halten. Er hat es sich niemals leichtgemacht, auch nicht mit seiner Ankunft im Westen, wohin es den 1956 Geborenen (…) nach der Wende verschlug. (…) In seinem Gepäck hat der das Mißtrauen mitgebracht, das ihn nirgendwo rasch heimisch werden läßt. (…) Als Anthologist hat Drawert im vergangenen Jahr mit ›Lagebesprechung‹ einen ›Umriß der jungen deutschen Lyrik‹ geboten und sich im Vorwort zu einem Satz Günter Eichs bekannt: ›Ich habe meine Hoffnung/ auf Deserteure gesetzt.‹ Desertion ist tatsächlich ein Schlüsselwort zum Verständnis vieler Texte Drawerts. Dieser Schriftsteller kämpft und schreibt unter keiner Fahne. Der Preis ist hoch: Er heißt Isolation. Nur einmal singt Drawert das Hohelied der Freundschaft, im vierteiligen Gedicht ›Zbigniew Herbert‹: ›er war uns im Kopf, / der Osten, dieser Krieg/ der Sprache gegen die Sprache, /dieses schreckliche Volksstück der Vorvormoderne.‹ Und nun folgt die Anrede an den polnischen Freund: ›Also wohin, /Genosse Deserteur?‹ Auch dieser Freund, an dessen Sterbebett er tritt, also ein Fahnenflüchtiger. Die Verse für den Gleichgesinnten sind wohl die schönsten des Bandes, ein lyrisches Requiem. (…) Auf einer Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn, über die Drawert auch in einem exzellenten Stück Prosa, dem Essay ›Nach Osten ans Ende der Welt‹ (im Band ›Rückseiten der Herrlichkeit‹, 2001), berichtet hat, kommt dem Reisenden das Zeitgefühl abhanden. ›Mit Blick auf eine Uhr, /der die Zeiger fehlen, und im Rhythmus/ mitgezählter Schienenschläge, … geht die Fahrt/ jetzt im Rückwärtsgang weiter, die Zeitzonen/ abwärts.‹ Aber Drawert ist kein Lyriker, der sich in eine poetische Phantasiewelt und ihre Zeitlosigkeit, in gemüthafte Innerlichkeit zurückzieht. (…) Der Deserteur Drawert sucht keine Zuflucht in der Transzendenz – seine Engel sind allesamt säkularisierte Gestalten. (…) Der jegliche Gefolgschaft verweigernde Autor ist Skeptiker, Melancholiker. Er nimmt die Schutzlosigkeit hin, mit der er seine Freiheit bezahlt. Nicht nur auf den ›goldenen Stühlen‹ sitzt dieser Autor nicht, sondern auch nicht auf den bequemen. Aber in unserer Gegenwartslyrik ist sein Platz in der ersten Reihe.«
Aus: »Die Zeitzonen abwärts. Vom lyrischen Leben kopfunter« von Walter Hinck, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.3.2002.
»Kurt Drawert hat das Gedicht in einem durchaus emphatischen Sinne essayistisch als ›Generator‹ und Kommunikat zugleich beschrieben, er betont die dialogische und existentielle Dimension des Poetischen. (…) Das Besondere an den Gedichten von Kurt Drawert war es stets schon, daß er diesen Überschuhs einem Material abgewinnt, das oft aus vorgestanzten Bildschablonen, von inflationärem Gebrauch verschlissenen Wortmünzen, aus defekten Satzfertigteilen besteht. (…) Es entstehen semantische Wirbel, Irrläufer oder Ausschließlichkeitskonstellationen. Die Bewegung der Verse wird durch Enjambements aufgehalten, durch Wiederholungsfiguren in die Schleife gezwungen, durch Metaphern geteilt, durch sarkastische Pointen synkopiert, durch Imaginationen vervielfacht. Das ist raffiniert gemacht und gleicht nicht selten einer Wildwasserfahrt mit Stromschnellen und Untiefen. (…) Besonders in den längeren poetischen Landnahmen (…) beweist sich Drawerts Fähigkeit, das geschichtlich Bedrängende in der Textur des scheinbar diaristisch Flüchtigen zu verdichten. (…) Drawerts tiefschwarzer Humor ist von einer ansteckenden, aberwitzigen Fröhlichkeit, die nach innen blutet. Das Eingeklemmtsein in industriell gefertigte Bilder und Töne, die Einspeisung fast aller Gebrauchsgegenstände einschließlich der Restnatur in pure Warenkreisläufe (…) wird in den verheerenden Konsequenzen um so deutlicher, wenn Mythen- und Utopiesplitter zitiert werden, wie im Aufrufen der ›Engel‹. (…) Als einen ›Deserteur‹ bezeichnete Walter Hinck ihn in einem Rundfunkgespräch, der sich von keiner der reichlich zuhandenen Vereinnahmungstechniken affizieren und sich den Blick auf die vor aller Augen sich vollziehenden Auflösungsprozesse von Gesellschaft nicht verkleistern lasse. Der große Matador der Germanistik verstand dies als Auszeichnung. (…) Ich habe nicht oft in den letzten Jahren so weltöffnende Gedichtbände lesen können wie die von Drawert und Grünbein. Aus der Flut neubiedermeierlicher Harmlosigkeiten ragen sie sowieso hervor.‹
Aus: ›Überschüsse, Symptome, Mythen. Zwei neue Gedichtbände von Durs Grünbein und Kurt Drawert‹ von Peter Geist, in: FREITAG, 22.3.2002.
» – ›Überall Brände, / alle U-Boote sinken. Das Arbeitsamt online/ … Nietzsche auch tot, mehrfach. Von oben betrachtet – das reine Wissenschaftschaos.‹ Die Diktion der Verse erinnert ein bißchen an Jakob van Hoddis und sein berühmtes ›Weltende‹. Das ist wohl bezweckt, denn eines haben sie gemein. Auch Drawert entpuppt sich als fröhlicher Apokalyptiker, als heiterer Kommentator der Abendröte im Abendland. Man folgt ihm mit Lust auf den Fährten des Untergangs, man lotet gern mit ihm die Untiefen einer strauchelnden Zivilisation aus, weil sein Stil fesselt. Das Pendeln zwischen verzweifelter Ironie und romantischer Euphorie ist beispiellos. Diese Mischung beherrscht nur er allein.«
Aus: »Der Anfang vom Abgesang. Drawert erweist sich erneut als fröhlicher Apokalyptiker« von Ulf Heise, in: Freie Presse, 15.3.2002.
»Frühjahrskollektion zeichnet sich durch Vielfalt an Themen und lyrischen Formen aus. Drawert beherrscht sie alle, versteht sie in Zwiesprache mit Vorbildern (Walther von der Vogelweide, Hölderlin) zu setzen. (…) Über allen Zeilen aber bleibt das Fazit, daß das sprachliche Vermögen und die dichterische Ernsthaftigkeit, die Drawerts Poesie auszeichnen, derzeit zum Eindrücklichsten in deutscher Sprache gehören.«
Aus: »Zwischen den Zeilen« von Beat Mazenauer, in: Der Landbote Winterthur, 25.5.2002
»Kurt Drawert hat nach Spiegelland. Ein deutscher Monolog, einem Roman über die Schwierigkeiten, sich aus Sprachzwängen zu befreien, und zahlreichen glänzenden Essays über den Stand der Wiedervereinigung mit diesem Gedichtband erneut bestätigt, daß er zu den wichtigsten und sprachmächtigsten deutschsprachigen Gegenwartsautoren zählt. Es wird Zeit, daß er seiner Bedeutung entsprechend wahrgenommen wird.«
Aus: »Der harte Stoff Wirklichkeit« von Michael Opitz, in: Neues Deutschland, 8.7.2002
Stiller Sonntag
Außer dem Zeiger der Uhr
bewegt sich nichts von der Stelle.
Die ermüdeten Vögel
kamen schon gestern
von ihrer Reise zurück,
und auch die Seite des Buches,
von der aus sie einmal weg
und davon fliegen wollten,
blieb wohlweislich gleich
aufgeschlagen. Der Himmel
sei nicht begehbar, sagen sie
und lassen die Köpfe
über einem Fachbericht hängen.
Von Sonntag zu Sonntag,
von Aufbruch zu Aufbruch,
es ist immer dasselbe.
Veränderungen gibt es nur noch
im Farbdruck der Zeitung –
das glühende Rot der Radieschen,
der Zukunft zugewandt,
das scharfe Gelb
einer Spargelcremesuppe.
Und daneben die Pötte,
unabgewaschen. Kein Satz
schrieb sich weiter, keine Liebe
webte am Faden
der Geheimnisses fort.
Die Autos sind eingeparkt
zum Victoriazeichen,
die Volkszählung beginnt.
Dein blauer Anzug im Fenster,
das müßte reichen.
Keine Zeit
Kaum wache ich auf,
habe ich schon keine Zeit mehr.
Der erste Abgang der Hunde
liegt bereits auf der Treppe,
und auch das Postfach ist voll
bis zum Anschlag. Alles
mit Dringlichkeitsnachweis,
Rückschein und Mahnfrist.
Die Stimme im Rundfunk:
gedämpft. Mit dem Land
ginge es abwärts, heißt es.
Kein Fußball, kein Tennis,
das durchzieht, es ist die reine
Aussicht auf gar nichts.
Jemand kratzt an der Haustür
und will, daß ich öffne.
Es kann nur der Tod sein
im Anzug eines Handelsvertreters
mit Rabattangeboten. Er stiehlt
Augenblicke und verkauft sie
als Uhren. Ich täusche
Demenz vor und überschlage,
wie viele Jahre noch bleiben
bis zum letzten großen Abflug.
Das flackernde Licht
vom Nachrichtenspeicher
bestätigt das Ticket. Rettung,
wenn überhaupt,
kommt von den Fehlanzeigen.
Zwischen den Zeilen
1
Es gibt viele schöne Dinge
für ein Gedicht, die ein Gedicht
nicht mehr brauchen,
weil sie schon schön sind.
2
Dennoch, ich wollte sie nennen, alle,
bis zur weißen Blüte der Kirsche.
3
Aber immer, zwischen den Zeilen,
bleibt etwas übrig.
Wintergedicht
Leicht fällt das Jahr in den Schnee,
und langsam sinkt auch das Licht.
Schon sehe ich nicht, wo du bist.
Und mit dem Dunkel dann ist,
daß ich gar nichts versteh.
An meinem Fenster vor Zeiten
zogen die Schwäne vorbei.
Ich fürchte, sie kamen nicht weit,
weil es doch lange schon schneit,
in allen Einsamkeiten.
Schnee hat im weißen Schleier
zum Rätsel nun alles vereint.
Es schweigen die Bücher am Ende.
Vielleicht, es sprechen die Wände.
Die Raben über dem Weiher.
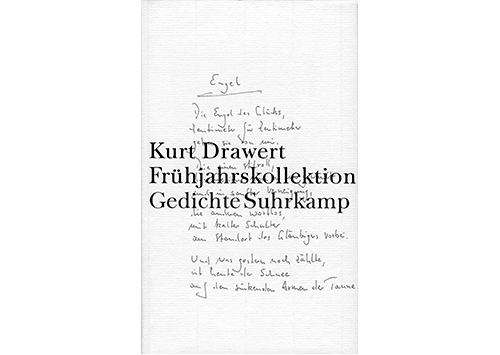
»Frühjahrskollektion«
Gedichte
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M., 2002
96 Seiten, EUR 15,00
ISBN 3-518-41304-X